Agroforstsysteme und das Modellprojekt in Thomasburg
Zwischen nachhaltiger Landnutzung, Naturschutz und Klimaanpassung


Agroforstsysteme- Eine alte Idee mit neuer Relevanz
Stellen wir uns eine landwirtschaftlich genutzte Fläche vor, auf der nicht nur Getreide oder
Mais wachsen, sondern auch Bäume stehen, Beerensträucher blühen, Kräuter duften und
Hühner zwischen den Gehölzen scharren. Was auf den ersten Blick wie ein Garten Eden wirkt,
ist in Wahrheit ein Agroforstsystem, ein agrarökologisches Konzept, das unterschiedliche
Nutzpflanzen und oft auch Tiere auf einer Fläche miteinander verbindet.
Im Kern beschreibt eine Agroforstwirtschaft die gleichzeitige oder zeitlich versetzte Nutzung
landwirtschaftlicher Flächen für die Kultivierung von Gehölzen und Ackerkulturen bzw.
Weidewirtschaft. Dabei ist das Prinzip nicht neu. Man denke an historische Streuobstwiesen
oder Waldweiden in Europa. Doch angesichts der Herausforderungen durch
Biodiversitätsverlust, Bodendegradation und den Klimawandel erhält dieses Konzept
heutzutage eine neue Aufmerksamkeit.
Doch wie sieht das konkret aus? Ein Blick nach Thomasburg auf den Hof Küselberg liefert
Antworten.
Das Modellprojekt Hof Küselberg in Thomasburg: Ein Reallabor für zukunftsfähige Landwirtschaft
In der Gemeinde Thomasburg in Niedersachsen entsteht derzeit ein besonders ambitioniertes Agroforstprojekt. Eines, das Wissenschaft, Praxis und Regionalentwicklung auf innovative Weise miteinander verknüpft. Auf einer fünf Hektar großen Fläche wird ein sogenanntes pastorales Agroforstsystem am Hof Küselberg etabliert, das vielfältige Gehölzpflanzungen, Ackerbau, Tierhaltung und Elemente der Permakultur integriert.
Die Planung und Umsetzung des Projekts erfolgte durch Baumfeldwirtschaft deutsche
Agroforst GmbH.
Was dieses Projekt besonders macht, ist sein ganzheitlicher Ansatz. Es geht nicht nur um die
Produktion von Lebensmitteln, sondern auch um Bodenaufbau, Biodiversitätsförderung,
Klimaschutz und regionale Wertschöpfung. Dabei orientiert sich die Planung am Prinzip einer regenerativen Landwirtschaft, die nicht nur Schäden minimiert, sondern aktiv ökologische Resilienz aufbaut.
Thomasburg ist damit mehr als nur ein landwirtschaftlicher Modellstandort – es ist ein echtes
Reallabor, das zeigt, wie nachhaltige Landnutzung in der Praxis funktionieren kann. Doch
damit das Zusammenspiel auch wirklich gelingt, braucht es vor allem eins: einen klugen
Umgang mit Wasser. Und genau an dieser Stelle setzt das sogenannte Keyline-Design an.
Das Keyline-Design ist eine innovative Methode zur landschaftsangepassten
Wasserverteilung, die vom australischen Landwirt und Ingenieur P. A: Yeomans entwickelt
und vom Dipl. -Forstwirt Philipp Gerhardt ausgearbeitet wurde.

Das Prinzip ist ebenso elegant wie effektiv: Statt Regenwasser oberflächlich abfließen zu lassen, wird es gezielt entlang der topographischen Linien, den sogenannten Keylines, verteilt und in den Boden geleitet.
Diese Linien markieren Stellen im Gelände, an denen sich die Hangneigung verändert, das Wasser sich verlangsamt und damit besser in den Boden einsickern kann. In Thomasburg wurden die Gehölzstreifen entlang des Keyline-Designs strategisch ausgerichtet, um das Wasser gleichmäßig in der Fläche zu halten und somit das sieben Meter hohe Gefälle zu bewältigen. Das Keyline-Design soll durch ein umfangreiches Gewässerleitungssystem ergänzt werden, das die Permakultur, das Gewächshaus und das Agroforstsystem speist. Die Gehölzstreifen an
den Keylines sind nicht willkürlich angeordnet, sondern folgen den Höhenlinien des Geländes. So wird sichergestellt, dass alle Pflanzen optimal vom Sonnenlicht profitieren, während Windschutz und gezielte Schattenbildung berücksichtigt werden.
Pflanzen in Etagen mit Tieren als Mitgestalter
Wer in ein paar Jahren über die Fläche in Thomasburg geht, wird schnell merken: Hier wächst nicht alles auf einer Höhe – und das ist gewollt. Die im April 2025 durchgeführte Pflanzaktion setzte dafür einen ersten Impuls.

————-
Es wurden vor allem Wertholzbäume wie Walnuss-, Esskastanien- und Eschenbäume gepflanzt. Ihre Früchte sind nicht nur wertvoll, sie leisten auch einen Beitrag zum Klimaschutz und können nach einigen Jahren zudem als Holzlieferanten dienen.
Doch nicht nur Pflanzen, sondern auch
Tiere prägen das System. Neben den
bereits auf dem Hof lebenden Schafen
sollen in Zukunft auch Hühner im
Agroforst zu finden sein. Mit ihrem
Scharrverhalten durchkämmen sie die
Bodenoberfläche, fressen Larven und
Schädlinge und liefern nebenbei Eier. Um
sie zu schützen, wurde bereits ein
weitläufiger und tiefgründiger
Wolfschutzzaun um das Keyline-Design
errichtet. Dieser soll vor allem Fressfeinde
wie Füchse und Wölfe abhalten.
So entsteht ein System, in dem Pflanzen
und Tiere nicht nur nebeneinander,
sondern miteinander wirken.
c/o: Annike Aschenbrenner

Der Zauberwald
Angrenzend an das bestehende Agroforstsystem werden die Planungen für einen Waldgarten
vorangetrieben. Derzeit entstehen in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Baumrausch
GmbH & Co. KG die ersten Bepflanzungskonzepte für die 0,4 Hektar große Fläche. Die
Umsetzung ist für Herbst 2025 vorgesehen.
Auch wenn bisher noch keine Bäume, Sträucher oder Bodendecker gepflanzt wurden, kann
sich der Hofbetreiber seinen „Zauberwald“ bereits bildlich vorstellen. Denn was anfangs noch
zurückhaltend wirkt, wird sich nämlich in wenigen Jahren zu einem lebendigen Ökosystem
entwickeln.
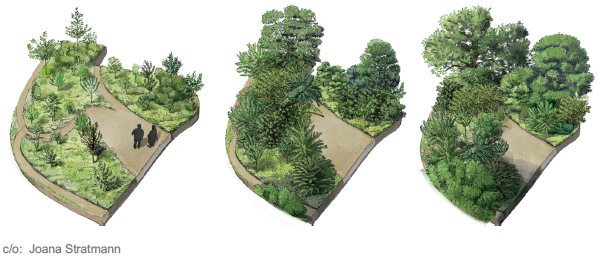
Doch wo genau liegt der Unterschied zum Agroforst? Ein Waldgarten zeichnet sich durch eine
vertikale Pflanzenstruktur mit überwiegend essbaren und mehrjährigen Pflanzen aus. Ein
typischer Waldgarten besteht aus sieben bis acht Schichten und orientiert sich dabei an der
natürlichen Walddynamik.
- Obere Baumschicht
- Untere Baumschicht
- Strauchschicht
- Krautschicht
- Bodendeckerschicht
- Wurzelschicht
- Rankenschicht
- + ggf. Myzelschicht
Die verwendeten Pflanzen sind in funktionellen Gruppen angeordnet, die sich gegenseitig
ergänzen, sodass die positiven Wechselwirkungen maximiert werden. Neben essbaren
Gewächsen wie Obstgehölzen, Kräutern, Stauden und Beerensträuchern spielen auch
Pionierpflanzen und stickstofffixierende Pflanzen wie der Beinwell eine Rolle. Sie sind sowohl
bei der Bodenvorbereitung als auch bei der Strukturentwicklung hilfreich.
Zusätzlich zu bekannten Beerensträuchern wie Johannisbeeren oder Himbeeren werden in
dem Zauberwald des Hofs Küselberg auch exotische Pflanzen wie die Kiwi, Feigen oder auch
der chinesische Gemüsebaum Platz finden.
Die zentralen Funktionen dieses Vorhabens sind Erholung, Bildung und Ernährung. Der
Waldgarten wird als Naschgarten allen zukünftigen Besucherinnen und Besuchern
offenstehen. Egal, ob Feriengäste, Café- und Restaurantbesucher oder
Seminarteilnehmende. Alle sind eingeladen, sich inspirieren zu lassen, Neues zu entdecken und dabei zu naschen. Die Überschüsse aus der Ernte sollen künftig im entstehenden Hofcafé
oder -laden verarbeitet und regional vermarktet werden.
In enger Zusammenarbeit mit einer Seminargruppe der Leuphana Universität und der
Kunsthochschule Wandsbek entsteht hier zunächst eine Informationstafel, die Spaziergänger
neugierig und auf das entstehende Projekt aufmerksam machen soll. In den kommenden
Jahren ist geplant, weitere Tafeln im Gelände zu platzieren, die über Pflanzenarten,
ökologische Zusammenhänge und Funktionen des Waldgartens informieren.
Darüber hinaus gibt es weitere Visionen: Der Betreiber kann sich vorstellen, im Waldgarten
einen Lehr- und Bildungspfad für Kinder zu entwickeln. Spielerisch sollen sie dort die Natur
entdecken und verstehen lernen. Auch ein Waldkindergarten hätte Platz auf dem Hof und ist
Teil der langfristigen Idee Kindern von klein auf einen achtsamen und lebendigen Zugang zur
Natur zu ermöglichen.
Auch bei Pflege und Ernte steht das Gemeinschaftsprinzip im Vordergrund. Aktuell betreut
eine Vollzeitkraft die landwirtschaftlichen Flächen, perspektivisch sind zwei Stellen
vorgesehen. Bewohnerinnen und Bewohner des Hofs sind eingeladen, sich je nach
Möglichkeit einzubringen. Der Waldgarten soll nicht nur Nahrung und Ruhe schenken, sondern
auch den sozialen Zusammenhalt stärken.
Die ursprüngliche Idee geht auf eine Führung am „Hof an den Teichen“ in Rettmer zurück,
welche als Zündfunke des Projekts beschrieben wird.
Das Zusammenspiel aus Permakultur, Agroforst und Waldgarten –
Conrad Meinke
verbunden mit engagierten Mitbewohnern, einem gastronomischen
Angebot, Ferien auf dem Bauernhof und Veranstaltungen macht das
Projekt spannend für unterschiedliche Zielgruppen.
Parallel zur Entwicklung des Waldgartens werden auf dem Hof Küselberg neue Wohnungen
und Ferienhäuser geschaffen, die mittelfristig bezugsfertig sein werden. Sie ergänzen das
Gesamtkonzept und schaffen Wohnraum für Menschen, die sich aktiv in das Hofleben
einbringen möchten.
Was in Thomasburg entsteht, ist weit mehr als ein landwirtschaftliches Projekt. Es ist ein
Modell dafür, wie wir unsere Kulturlandschaft neu denken können.
Denn das Projekt zeigt eindrücklich, wie man durch regionale Bildungsarbeit, partizipative
Planung und praktische Ansätze ein zukunftsfähiges Verständnis von Landwirtschaft schaffen
kann, als Teil einer Gesellschaft, die sich wandelt und Antworten sucht. Antworten, wie sie in
Thomasburg heute schon sichtbar werden.

Kurzum: Das Projekt, welches zunächst als ambitionierte Vision entstand, trägt zunehmend mehr
und mehr Früchte.
c/o: Annike Aschenbrenner
.
Verwendete Literatur
Chalmin, A. (2008). Agroforstwirtschaft in Mitteleuropa: Potenziale und Perspektiven.
Göttingen: Cuvillier Verlag.
Crawford, Martin, Marion Smylie-Wild, und Joanna Brown (2010): Creating a Forest Garden:
Working with Nature to Grow Edible Crops. Cambridge, UNITED KINGDOM: UIT Cambridge
Ltd.
Entwurfsplanung Thomasburg. (2023). Projektunterlagen Agroforstsystem und Waldgarten
Thomasburg. Unveröffentlichtes Planungskonzept.
NABU. (2024). Agroforstwirtschaft: Chancen für Natur und Landwirtschaft. Naturschutzbund
Deutschland. https://www.nabu.de
Thomasburg LEADER-Präsentation. (2024). Modellprojekt Agroforstsystem Thomasburg:
Vorstellung im Rahmen der Regionalentwicklung. Interne Projektpräsentation.
Waldgartenwelten (o.D.) https://waldgarten.web.leuphana.de/faqs/
Zusätzlich:
Bachelorarbeit: Jonas Voll (2024): Die Pflanzbereichs- und Funktionsplanung des zukünftigen Permakulturhof Thomasburg
Semi-strukturiertes Interview & weitgehender Austausch mit Conrad Meinke